Pflegekräfte aus dem Ausland - und was ihre Kinder erleben
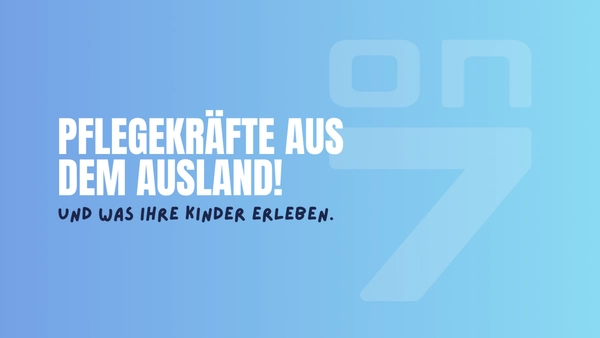
Migration als Familienentscheidung
Wenn internationale Pflegekräfte nach Deutschland kommen, betrifft das selten nur sie allein. Hinter fast jeder Ankunft steht eine Familie - Kinder, Partner:innen, Eltern. Migration ist kein individueller, sondern ein kollektiver Schritt. Sie verändert Beziehungen, Rollen und Lebenswege.
In Deutschland arbeiten aktuell rund 250.000 Pflegekräfte mit ausländischem Abschluss (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2024). Viele kommen aus Ländern wie den Philippinen, Indien, Bosnien oder Marokko. Oft reisen sie zunächst allein, um Sprachkurse und Anerkennungsverfahren zu absolvieren. Erst später folgen ihre Familien - manchmal nach Monaten, manchmal nach Jahren.
Dieser Prozess ist emotional anspruchsvoll: Die berufliche Integration in ein neues System läuft parallel zur familiären Neuorientierung.
Die stille Doppelbelastung
Pflegekräfte übernehmen Verantwortung in einem der anspruchsvollsten Berufe - körperlich, psychisch und sozial. Gleichzeitig sind viele von ihnen Eltern. Das bedeutet: Pflege im Beruf, Fürsorge zu Hause.
Schichtarbeit, Nachtdienste und unregelmäßige Arbeitszeiten machen es schwer, Familie und Beruf zu vereinbaren. Während Pflegekräfte anderen Menschen Stabilität geben, fehlt sie oft in ihrem eigenen Alltag. Studien zeigen, dass fast 60 Prozent der internationalen Pflegekräfte Schwierigkeiten haben, Kinderbetreuung und Arbeit zu koordinieren (Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, 2023).
Diese Mehrfachbelastung führt häufig zu chronischem Stress, Übermüdung und inneren Konflikten - zwischen beruflicher Verpflichtung und familiärer Nähe.
Kinder im Übergang
Für die Kinder der Pflegekräfte bedeutet Migration ein radikaler Neuanfang. Sie müssen Sprache, Schulsystem und soziale Normen gleichzeitig lernen. Besonders in den ersten Monaten nach dem Zuzug erleben viele eine Phase der Überforderung.
Laut einer Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) fühlen sich mehr als ein Drittel der Kinder mit Zuwanderungsgeschichte in den ersten Schuljahren ausgegrenzt oder unsicher (Quelle: DJI, 2023). Sprachdefizite, kulturelle Unterschiede und das Gefühl, „anders“ zu sein, erschweren den Start. Wenn die Eltern durch Arbeit und Sprachbarrieren stark belastet sind, fehlt oft die Zeit und Kraft, um die eigenen Kinder beim Ankommen intensiv zu begleiten.
Getrennt durch Entfernung, verbunden durch Pflicht
Viele Pflegekräfte entscheiden sich zunächst, ohne Familie nach Deutschland zu kommen. Diese Trennungsphasen können Monate oder Jahre dauern. Sie sollen Stabilität ermöglichen - führen aber häufig zu emotionaler Entfremdung.
In den Herkunftsländern wachsen Kinder in dieser Zeit bei Großeltern oder Verwandten auf. Forschungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zeigen, dass solche „Care Chains“ - also Pflege- und Sorgeketten über Ländergrenzen hinweg - langfristige psychologische Spuren hinterlassen (Quelle: ILO, 2023).
Kinder berichten von Schuldgefühlen, Einsamkeit und der Angst, ihre Eltern zu verlieren. Gleichzeitig tragen die Eltern das Gefühl, zwar für ein besseres Leben zu arbeiten, aber das Wichtigste im Moment zu verpassen.
Eine philippinische Pflegekraft formulierte es in einem Interview mit der WHO so: „Ich helfe anderen Müttern, ihre Kinder zu pflegen - während meine eigenen 10.000 Kilometer entfernt sind“ (Quelle: WHO, 2023).
Bildung als Schlüssel zum Bleiben
Ob Migration langfristig gelingt, hängt wesentlich von der Integration der Kinder ab. Bildung ist hier der wichtigste Hebel - nicht nur für die Zukunft der Kinder, sondern für die Entscheidung der Familien, in Deutschland zu bleiben.
Kinder, die sich in Schule und Freundeskreis integrieren, geben den Eltern Sicherheit und emotionale Stabilität. Umgekehrt führt schulische Ausgrenzung oder Misserfolg häufig zu Rückkehrgedanken.
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) weist darauf hin, dass Kinder von Fachkräften aus Drittstaaten häufiger Übergangsschwierigkeiten ins Regelschulsystem haben als Kinder aus EU-Staaten (Quelle: IW, 2024). Grund dafür sind Sprachdefizite und unzureichende Angebote für Schulbegleitung nach dem Zuzug.
Für viele Familien entscheidet sich Integration also nicht im Krankenhaus oder Pflegeheim, sondern im Klassenzimmer.
Warum das Thema in die Pflegepolitik gehört
Wenn Deutschland langfristig auf internationale Fachkräfte setzt, darf es ihre Familien nicht übersehen. Integration endet nicht beim Arbeitsvertrag. Sie gelingt nur, wenn auch Kinder und Partner:innen eine Perspektive finden.
Das bedeutet:
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch geeignete Arbeitszeitmodelle und verlässliche Kinderbetreuung.
- Sprach- und Bildungsförderung, die gezielt auf Migrantenkinder zugeschnitten ist.
- Psychosoziale Begleitung für Familien, die mit Trennung, Stress oder Identitätskonflikten kämpfen.
Pflegekräfte sichern die Versorgung in Deutschland. Doch um sie dauerhaft zu halten, braucht es Strukturen, die auch ihre Familien tragen.
Migration ist mehr als Arbeit
Internationale Pflegekräfte sind ein zentraler Teil der Lösung für den Fachkräftemangel. Aber sie sind auch Eltern, Partner:innen, Töchter und Söhne.
Ihre Geschichten zeigen: Migration bedeutet nicht nur Bewegung über Grenzen, sondern auch die Neudefinition von Nähe, Familie und Verantwortung.
Wenn Deutschland ein wirklich attraktiver Standort für Pflegekräfte bleiben will, muss es nicht nur Fachkräfte integrieren, sondern alle Menschen. Und dazu gehören auch ihre Kinder.
↳ Link zum LinkedIn-Beitrag