Regionale Versorgungslücken & Einwanderung: Warum Pflegekräfte nicht nur in Metropolen gebraucht werden
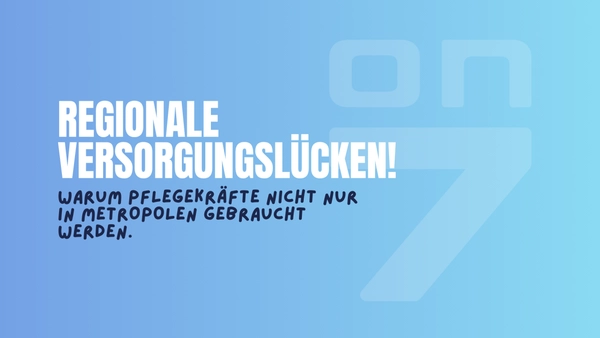
Wenn ganze Landkreise auf Hilfe warten
Der Pflegenotstand ist längst kein Zukunftsszenario mehr, sondern Realität - besonders außerhalb der großen Städte. Laut einer aktuellen Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft fehlen in Deutschland derzeit rund 115.000 Pflegefachkräfte, bis 2035 könnten es über 500.000 sein (Quelle: IW Köln, 2024).
Doch die Verteilung ist ungleich. Während Kliniken in Ballungsräumen noch Personal anziehen, kämpfen ländliche Regionen mit leeren Bewerbungslisten und geschlossenen Pflegeheimen. In Bayern, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern dauern Ausschreibungen für Pflegekräfte im Schnitt über 250 Tage, doppelt so lang wie in urbanen Zentren (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2024).
Die Folge: Ältere Menschen in strukturschwachen Gebieten haben schlechteren Zugang zu medizinischer und pflegerischer Versorgung - obwohl dort der Anteil der Pflegebedürftigen besonders hoch ist.
Demografischer Wandel trifft Regionen ungleich
Der demografische Wandel verschärft diese Schieflage. Während junge Menschen in die Städte ziehen, bleibt auf dem Land eine alternde Bevölkerung zurück. Schon heute leben dort rund 30 Prozent mehr über 65-Jährige als in Metropolregionen (Quelle: Statistisches Bundesamt, 2024).
Das bedeutet: Der Bedarf an Pflege steigt dort, wo das Personal fehlt. Und das ist kein reines Versorgungsproblem - es wird zunehmend zu einem wirtschaftlichen.
Laut einer Studie der KfW gilt der Fachkräftemangel inzwischen als größtes Wachstumshindernis in Deutschland - besonders in Gesundheits- und Sozialberufen (Quelle: KfW, 2024).
Wenn Pflegeheime, ambulante Dienste oder Krankenhäuser auf dem Land keine Mitarbeiter mehr finden, geraten ganze Regionen ins soziale Abseits. Familien übernehmen zusätzliche Pflegearbeit, Berufstätige reduzieren Stunden oder steigen ganz aus dem Erwerbsleben aus.
Migration als regionale Chance
Hier kann gezielte Fachkräftemigration ein entscheidender Hebel sein - wenn sie nicht nur als nationale, sondern als regionale Strategie gedacht wird.
Internationale Pflegekräfte konzentrieren sich bisher überwiegend auf Großstädte, weil dort Arbeitsplätze, Netzwerke und kulturelle Infrastruktur vorhanden sind.
Doch gerade kleinere Städte und ländliche Gemeinden könnten langfristig profitieren, wenn Integration dort strukturiert begleitet wird:
- geringere Lebenshaltungskosten,
- verfügbare Wohnflächen,
- stabile Gemeinschaften,
- direkter Kontakt zu Arbeitgebern.
Viele Pflegebetriebe auf dem Land bieten längst attraktive Rahmenbedingungen - vom verfügbaren Wohnraum über Familienintegration bis zu flexiblen Arbeitszeiten.
Was fehlt, ist Sichtbarkeit: internationale Pflegekräfte wissen häufig nicht, dass solche Chancen außerhalb der Städte existieren.
Eine gezielte digitale Steuerung der Fachkräftemigration - gekoppelt an regionale Bedarfsanalysen - könnte diese Lücke schließen.
Integration braucht Raum, nicht nur Arbeit
Arbeit ist der Einstieg, aber Wohnen ist das Ankommen.
Ländliche Regionen bieten hier einen kaum genutzten Vorteil: Platz. Während in Großstädten hohe Mieten Integration erschweren, stehen in vielen Landkreisen bezahlbare oder leerstehende Wohnungen zur Verfügung.
Wenn Unternehmen, Kommunen und Bildungsträger gemeinsam handeln, können sie diesen Vorteil nutzen.
Wohnungsbaugesellschaften, Landkreise und Pflegeeinrichtungen könnten gezielt Kooperationsmodelle schaffen: bezahlbarer Wohnraum, Sprachkurse vor Ort, kommunale Integrationsbegleitung.
So wird Migration nicht zum Fremdkörper, sondern zum Impuls regionaler Entwicklung.
Perspektive für Fachkräfte - Perspektive für Regionen
Viele internationale Pflegekräfte wünschen sich ein Umfeld, in dem sie wachsen können - beruflich und privat.
Ländliche Regionen bieten genau das: mehr Ruhe, mehr Nähe, mehr Möglichkeiten, sich zu verwurzeln.
Wer Integration ernst meint, sollte also nicht nur Metropolen stärken, sondern gezielt Regionen fördern, die Fachkräfte wirklich brauchen. Das bedeutet:
- gezielte regionale Migrationsprogramme,
- lokale Sprach- und Integrationszentren,
- kommunale Netzwerke, die Wohnen, Arbeiten und Bildung verbinden.
Wenn Fachkräftemigration so verstanden wird, profitiert nicht nur die Pflege - sondern das Land als Ganzes.
Pflege braucht Präsenz, nicht Postleitzahlen
Pflege ist kein urbanes Privileg.
Sie ist ein Grundpfeiler der Gesellschaft - überall.
Die ländlichen Räume Deutschlands dürfen nicht die Verlierer des Fachkräftemangels werden. Wenn Fachkräfte gezielt in Regionen gelenkt, dort gut ausgebildet und integriert werden, entsteht eine neue Form von Gleichgewicht: Menschen finden Arbeit, Regionen gewinnen Zukunft.
Jetzt braucht es Strukturen, die den Mut haben, Migration nicht nur zuzulassen - sondern strategisch zu gestalten.
Denn wer Pflege sichern will, muss sie dahin bringen, wo sie fehlt.
↳ Link zum LinkedIn-Beitrag