Rassismus in der Pflege: Ein unsichtbares Problem mit sichtbaren Folgen
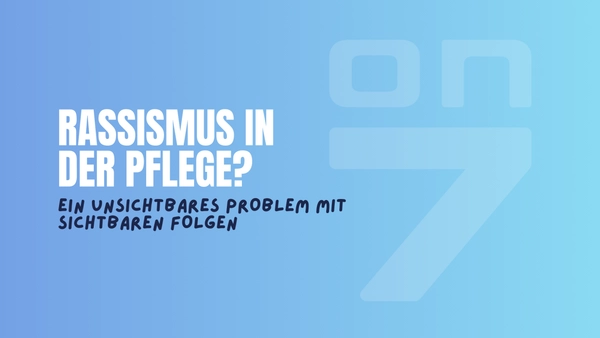
Alltag zwischen Fürsorge und Ausgrenzung
Pflegekräfte sollen Fürsorge leisten, Nähe schaffen und Vertrauen aufbauen. Doch für viele internationale Fachkräfte wird dieser Anspruch im Alltag zur Belastung. Eine alltägliche Situation wie das Anreichen von Wasser oder das Prüfen eines Verbands kann plötzlich kippen: „Sprechen Sie überhaupt richtig Deutsch?“ Solche Bemerkungen sind keine Ausnahme, sondern für viele Pflegekräfte Routine (Quelle: Springer Pflege, 2025).
Was eigentlich ein Ort der Fürsorge sein soll, wird so zum Ort der Ausgrenzung. Prof. Dr. Cinur Ghaderi von der Evangelischen Hochschule Bochum betont: „Der Anspruch auf Gleichheit trifft dabei oft auf eine Praxis, in der Diskriminierung leider immer wieder stattfindet - und dabei noch viel zu selten benannt und besprochen wird“ (Quelle: Springer Pflege, 2025).
Strukturelle Ursachen
Die internationale Zusammensetzung vieler Pflegeteams verschärft die Lage. Aufgrund des Fachkräftemangels werden verstärkt Pflegekräfte aus dem Ausland angeworben. Diese Vielfalt ist eine Stärke - birgt aber auch Konfliktpotenzial. Unterschiedliche kulturelle Hintergründe treffen auf hohen Arbeitsdruck und gesellschaftliche Polarisierung. „Die Arbeitsbelastung ist extrem hoch, Konflikte sind so vorprogrammiert“, erklärt die Pflegewissenschaftlerin Prof. Dr. Karin Tiesmeyer (Quelle: Springer Pflege, 2025).
Eine Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) zeigt, dass 41 % der befragten internationalen Pflegekräfte Diskriminierung durch Patient:innen erlebt haben, 27 % auch durch Kolleg:innen (Quelle: DeZIM, 2023). Die Grenze zwischen unbedachten Kommentaren, unbewussten Vorurteilen und offenem Rassismus ist oft fließend.
Formen von Rassismus im Pflegealltag
Rassismus im Pflegekontext zeigt sich in vielen Facetten:
- Offene Anfeindungen: Abwertende Bemerkungen zu Sprache, Herkunft oder Religion.
- Subtile Diskriminierung: Pflegekräfte werden übergangen oder nicht ernst genommen.
- Strukturelle Benachteiligung: Fehlende Aufstiegschancen, geringere Anerkennung ausländischer Qualifikationen.
Besonders perfide sind Situationen, in denen Patient:innen gezielt Pflegekräfte ablehnen - nicht wegen fehlender Kompetenz, sondern wegen Hautfarbe oder Herkunft. Laut einer Befragung der Hans-Böckler-Stiftung gaben 30 % der internationalen Pflegekräfte an, schon einmal abgelehnt worden zu sein, obwohl sie qualifiziert waren (Quelle: Böckler Stiftung, 2023).
Warum das Problem oft unsichtbar bleibt
Ein Grund, warum Diskriminierung selten thematisiert wird, ist die Unsicherheit vieler Betroffener. „Die Vorkommnisse bleiben oft unbesprochen. Das schafft Unsicherheit und Scham: Viele Pflegende wüssten schlicht nicht, wie sie reagieren sollen“, sagt Tiesmeyer (Quelle: Springer Pflege, 2025).
Auch in der Ausbildung wird das Thema bislang kaum behandelt. Rassismusforscherin Mary Lam betont: „In den sehr offenen Gesprächen mit den Studierenden zeigte sich, dass eigentlich alle schon einmal Diskriminierung in der Pflegearbeit erlebt haben“ (Quelle: Springer Pflege, 2025). Doch in Lehrplänen fehlt es meist an Raum, solche Erfahrungen zu reflektieren und Strategien für den Umgang zu entwickeln.
Folgen für Fachkräfte und Arbeitgeber
Die Konsequenzen sind gravierend. Diskriminierung schwächt die psychische Gesundheit, führt zu Demotivation und steigert die Fluktuation. Eine Studie der OECD zeigt, dass internationale Fachkräfte deutlich häufiger vorzeitig den Beruf wechseln oder Deutschland wieder verlassen, wenn sie Diskriminierungserfahrungen machen (Quelle: OECD, 2023).
Für Arbeitgeber bedeutet das nicht nur einen Verlust an Personal, sondern auch steigende Kosten. Rekrutierung, Einarbeitung und Abwanderung summieren sich zu einem massiven Risiko für die Versorgungssicherheit.
Tipps für den Pflegealltag - Haltung, Handlung, Schutz
Das Forschungsteam der Evangelischen Hochschule Bochum empfiehlt einen dreistufigen Ansatz, um Pflegende im Alltag zu unterstützen (Quelle: Springer Pflege, 2025):
- Haltung: Eine empathische, selbstreflektierte und antirassistische Grundhaltung entwickeln und im Team vorleben.
- Handlung: Bei diskriminierenden Vorfällen aktiv einschreiten, nachfragen („Was meinen Sie damit?“), Hilfe holen und Betroffene stärken.
- Schutz: Strukturen schaffen - durch Deeskalationstrainings, klare Beschwerdewege, sensibilisierte Leitungsteams und Schutz für „Whistleblower“.
Bildungseinrichtungen in der Pflicht
Auch Ausbildungsstätten müssen mehr Verantwortung übernehmen. „Als Hochschule haben wir den Anspruch, Wissen zu vermitteln, aber auch ein Bewusstsein für transkulturelle Herausforderungen zu schaffen“, betont Ghaderi (Quelle: Springer Pflege, 2025). Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung seien sichere Räume für Austausch und Reflexion entscheidend.
Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts bestätigt: Themen wie Rassismus und Diskriminierung werden in der Pflegeausbildung bislang kaum systematisch aufgegriffen, obwohl fast alle Befragten eigene Erfahrungen damit haben (Quelle: DJI, 2024).
Ein Thema, das nicht länger tabu sein darf
Rassismus im Pflegealltag ist kein Randphänomen, sondern Realität für viele internationale Fachkräfte. Er äußert sich in Bemerkungen, Ablehnung und subtilen Benachteiligungen - und bleibt zu oft unbenannt. Die Folgen reichen von psychischer Belastung bis zu Abwanderung, was den Fachkräftemangel weiter verschärft.
Wenn Deutschland auf internationale Pflegekräfte setzt, darf es das Thema nicht länger tabuisieren. Es braucht Bewusstsein, klare Strukturen und Räume für Reflexion. Denn Pflege kann nur dann Ort der Fürsorge sein, wenn sie auch für die Pflegenden frei von Ausgrenzung ist.
↳ Link zum LinkedIn-Beitrag