Solidarprinzip oder Eigenvorsorge - Wohin steuert die Pflegefinanzierung?
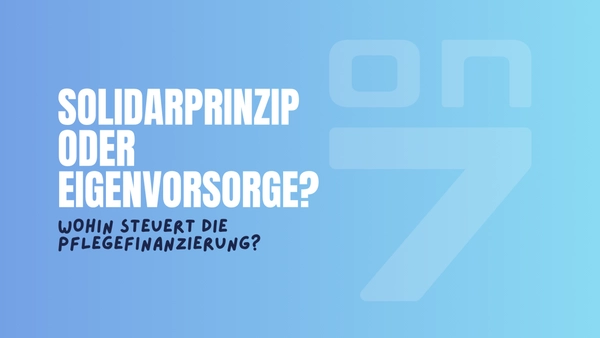
Die Pflegekosten steigen seit Jahren, der demografische Druck wächst - und die Frage wird drängender: Soll Deutschland weiter primär auf solidarische Finanzierung setzen oder stärker auf private Eigenvorsorge? Die Antwort wird maßgeblich bestimmen, wie tragfähig der Sozialstaat in den kommenden Jahrzehnten bleibt.
Eine tragende Säule unter Druck
Die gesetzliche Pflegeversicherung wurde 1995 als fünfte Säule der Sozialversicherung eingeführt, um das Risiko der Pflegebedürftigkeit solidarisch abzusichern. Sie arbeitet im Umlageverfahren: Die Beiträge der aktuell Erwerbstätigen finanzieren die Leistungen für Pflegebedürftige (Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, 2024).
Doch das System steht unter massivem Druck. 2023 lag der Beitragssatz bei 3,4 % für Eltern und 4,0 % für Kinderlose (Quelle: GKV-Spitzenverband, 2024). Parallel stiegen die durchschnittlichen Eigenanteile für stationäre Pflegeplätze auf rund 2.600 Euro pro Monat (Quelle: Verband der Ersatzkassen, 2024).
Der demografische Wandel verstärkt die Schieflage: Bis 2050 steigt der Anteil der über 67-Jährigen auf voraussichtlich 28 % der Bevölkerung (Quelle: Statistisches Bundesamt, 2024). Weniger Beitragszahler müssen für mehr Pflegebedürftige aufkommen - ein klassisches Umlage-Dilemma.
Solidarprinzip - Fundament und Belastungsfaktor zugleich
Das Solidarprinzip bedeutet: Alle zahlen einkommensabhängig ein, unabhängig vom individuellen Pflegerisiko. Gutverdienende leisten überproportional, Kinderlose zahlen einen Zuschlag. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich die Kosten. Es verhindert, dass Pflegebedürftigkeit zwangsläufig zu Armut führt.
Allerdings steigt der Preis: Höhere Beitragssätze erhöhen die Lohnnebenkosten und können die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Schon heute warnt der Sachverständigenrat Gesundheit, dass ohne Reform die Beitragssätze bis 2040 auf über 5 % steigen könnten (Quelle: SVR Gesundheit, 2024).
Ein weiteres Risiko: Das Umlagesystem ist anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. In Rezessionen sinken die Beitragseinnahmen, während der Pflegebedarf konstant hoch bleibt. Zudem führen steigende Lebenserwartung und medizinischer Fortschritt zu längeren Pflegezeiten - aktuell liegt die durchschnittliche Dauer der Pflegebedürftigkeit bei 6,7 Jahren für Frauen und 4,5 Jahren für Männer (Quelle: Statistisches Bundesamt, 2024).
Eigenvorsorge - mehr Verantwortung beim Einzelnen
Befürworter einer stärkeren Eigenvorsorge sehen darin den Schlüssel, um das Umlagesystem zu entlasten. Denkbar sind verpflichtende Kapitalrücklagen oder geförderte Zusatzversicherungen, die neben der gesetzlichen Pflegeversicherung greifen.
Internationale Beispiele zeigen Alternativen: In Singapur zahlen Erwerbstätige in ein obligatorisches Vorsorgekonto (CPF) ein, das auch für Pflegekosten genutzt werden kann (Quelle: Ministry of Health Singapore, 2024). Die Mittel gehören den Versicherten, sind aber zweckgebunden.
In den Niederlanden existiert ein stark steuerfinanziertes Modell, das hohe Leistungen garantiert, aber auch hohe Abgaben erfordert - der Beitragssatz für die dortige Langzeitpflegeversicherung liegt bei rund 9,65 % des steuerpflichtigen Einkommens (Quelle: RIVM, 2024).
In Deutschland bieten private Versicherer Pflegetagegeld- und Pflegekostenversicherungen an. Die Verbreitung ist jedoch gering: Nur etwa 5 % der Bevölkerung verfügen über eine private Zusatzversicherung (Quelle: GDV, 2024). Gründe sind geringe Bekanntheit, Skepsis gegenüber Versicherern und die Fehleinschätzung, dass die gesetzliche Pflegeversicherung im Ernstfall alle Kosten deckt.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen
Steigende Beitragssätze bedeuten höhere Lohnnebenkosten für Unternehmen und sinkendes Nettoeinkommen für Beschäftigte. Hohe Eigenanteile im Pflegefall belasten Angehörige und können zu Sozialhilfebedarf führen. Schon heute beziehen rund ein Drittel der Pflegeheimbewohner ergänzende Sozialhilfe, weil ihre Rente nicht ausreicht (Quelle: Paritätischer Gesamtverband, 2024).
Ein intelligenter Mix als Ausweg
Deutschland steht vor einer Grundsatzentscheidung: Das Solidarprinzip unverändert lassen und steigende Beiträge akzeptieren - oder Eigenvorsorge ausbauen und das individuelle Risiko erhöhen. Wahrscheinlich führt kein Weg an einer Mischform vorbei.
Ein mögliches Zukunftsmodell: eine solidarische Grundabsicherung, die den Basispflegebedarf deckt, ergänzt durch verpflichtende oder steuerlich geförderte Eigenvorsorge.
Klar ist: Je länger grundlegende Reformen ausbleiben, desto drastischer müssen sie später ausfallen.
↳ Link zum LinkedIn-Beitrag