Anerkennung oder Kenntnisprüfung - welcher Weg ist schneller, fairer, besser?
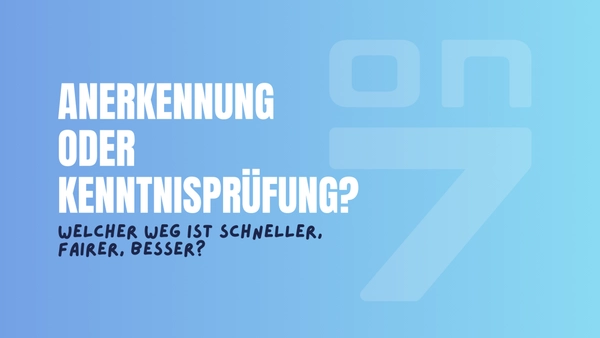
Deutschland steht unter Druck: Der Fachkräftemangel spitzt sich zu, insbesondere in der Pflege, wo bis 2050 rund 690.000 Fachkräfte fehlen werden (Quelle: Statista, 2024). Internationale Talente sind gefragt, doch der Weg in den Beruf ist steinig. Wer mit einem Abschluss aus dem Ausland nach Deutschland kommt, landet zwangsläufig in einem der beiden Verfahren - dem Anerkennungsverfahren oder der Kenntnisprüfung. Beide Wege verfolgen dasselbe Ziel, nämlich die Gleichwertigkeit mit deutschen Standards sicherzustellen, unterscheiden sich jedoch fundamental in Ablauf, Dauer und Belastung für die Fachkräfte.
Das Anerkennungsverfahren - gründlich, aber langwierig
Im klassischen Anerkennungsverfahren werden Ausbildungsinhalte, Nachweise und Berufserfahrungen detailliert geprüft. Ziel ist es, eine formale Gleichwertigkeit mit dem deutschen Berufsabschluss festzustellen. Liegen alle notwendigen Unterlagen vollständig vor, kann eine direkte Anerkennung erfolgen. Weichen Inhalte ab, werden Ausgleichsmaßnahmen vorgeschrieben - etwa Anpassungslehrgänge oder Hospitationen, die in Deutschland absolviert werden müssen (Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2024).
So nachvollziehbar dieser Ansatz ist, so problematisch ist seine Praxis. Im Durchschnitt dauert eine Anerkennung in der Pflege über 500 Tage (Quelle: Statista, 2024). Das liegt an komplexen Verfahren, föderalen Unterschieden, Engpässen bei Prüfbehörden und einem Mangel an qualifizierten Prüfern (Quelle: Deutsches Ärzteblatt, 2023). Für Unternehmen bedeutet dies, dass dringend benötigte Fachkräfte über Monate oder gar Jahre nicht einsetzbar sind, während Bewerber in dieser Zeit in Ungewissheit leben. Gerade kleinere Einrichtungen verlieren dadurch die Geduld oder verzichten ganz auf internationale Rekrutierung (Quelle: IAB Forschungsbericht, 2024).
Die Kenntnisprüfung - schneller, aber nicht ohne Tücken
Eine Alternative ist die sogenannte Kenntnisprüfung. Sie richtet sich an Fachkräfte, deren Ausbildung nicht als vollständig gleichwertig eingestuft wird, und prüft direkt, ob die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten vorhanden sind. Im Kern bedeutet dies: Nicht die Dokumente entscheiden, sondern die Praxis. Wird die Prüfung bestanden, kann die Fachkraft unmittelbar eingesetzt werden (Quelle: Anerkennung in Deutschland, 2024).
Auf den ersten Blick ist dies der schnellere Weg, weil langwierige Unterlagenprüfungen wegfallen. Allerdings zeigen sich auch hier Hürden. Prüfungen sind anspruchsvoll und bundesweit nur begrenzt verfügbar. Termine sind rar, Wartezeiten oft mehrere Monate lang (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2024). Zudem besteht die Gefahr, dass sprachliche Unsicherheiten oder Prüfungsstress das Ergebnis beeinflussen - selbst wenn die fachlichen Fähigkeiten vorhanden sind (Quelle: Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, 2023). Fairness wird so zu einer Frage der individuellen Prüfungssituation.
Fairness und Effizienz - zwei Kriterien, ein Dilemma
Vergleicht man beide Verfahren, wird deutlich: Das Anerkennungsverfahren ist gründlicher, aber zu langsam. Die Kenntnisprüfung ist praxisnäher, aber von Kapazitäten und individuellen Umständen abhängig. Beiden Wegen ist gemeinsam, dass sie weder flächendeckend effizient noch fair genug sind, um den Herausforderungen gerecht zu werden (Quelle: OECD, 2023).
Für die Fachkräfte bedeutet dies eine enorme Belastung. Viele reisen mit großen Erwartungen nach Deutschland und finden sich in einem System wieder, das sie mit Papierstapeln, Wartezeiten und Unsicherheit konfrontiert (Quelle: BIBB, 2023). Für Unternehmen wiederum sind die Verfahren schwer planbar, was Investitionen in internationale Rekrutierung unattraktiv macht. Und für die Gesellschaft bedeutet es, dass dringend benötigte Unterstützung in der Pflege oft über Jahre blockiert bleibt (Quelle: Bertelsmann Stiftung, 2024).
Reformbedarf - Digitalisierung und Standardisierung
Die eigentliche Schwäche liegt nicht im Grundprinzip beider Wege, sondern in deren Umsetzung. Solange Anerkennungsverfahren in Papierakten geprüft werden und Termine für Kenntnisprüfungen monatelang auf sich warten lassen, wird keine dieser Optionen ihrer Aufgabe gerecht. Digitalisierung, Standardisierung und Kapazitätsaufbau sind die Schlüssel, um beide Verfahren fairer und schneller zu machen (Quelle: Sachverständigenrat für Integration und Migration, 2024).
Plattformlösungen wie ON7 zeigen, dass Verfahren nicht nur digital abgebildet, sondern auch beschleunigt werden können. Digitale Skills-Labs, standardisierte Curricula und eine eigene Prüferausbildung sind Beispiele, wie man Engpässe überwindet und Fachkräfte schneller in den Arbeitsmarkt integriert. Das geplante Anerkennungszentrum in Würzburg verfolgt genau diesen Ansatz: Kompakte Intensivkurse, teilweise bereits im Herkunftsland absolviert, gefolgt von einer unmittelbaren Kenntnisprüfung - eine Kombination, die Fairness und Geschwindigkeit verbindet.
Die Zukunft liegt im hybriden Modell
Die entscheidende Frage lautet nicht länger, ob Anerkennung oder Kenntnisprüfung der bessere Weg ist. Beide Verfahren haben ihre Berechtigung und werden auch in Zukunft koexistieren. Aber sie müssen intelligenter miteinander verknüpft werden. Ein hybrides Modell, das die Stärken beider Ansätze kombiniert - die Validität des Anerkennungsverfahrens und die Praxisnähe der Kenntnisprüfung - könnte die Antwort sein (Quelle: OECD Health Report, 2024).
Dazu braucht es klare Standards, digitale Prozesse und ausreichend Prüfer, um Wartezeiten zu verkürzen. So entsteht ein System, das Fachkräften Planungssicherheit gibt, Unternehmen schnelle Lösungen bietet und letztlich die Versorgung in der Pflege stärkt.
Deutschland hat keine Zeit zu verlieren. Jede Verzögerung bedeutet mehr offene Stellen, mehr Belastung für die bestehende Belegschaft und letztlich weniger Versorgungssicherheit für Patienten. Deshalb ist es höchste Zeit, Anerkennung und Kenntnisprüfung nicht länger gegeneinanderzustellen, sondern sie als zwei Seiten derselben Medaille zu begreifen - und endlich die Strukturen zu schaffen, die diesen Anspruch auch einlösen (Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, 2024).
↳ Link zum LinkedIn-Beitrag